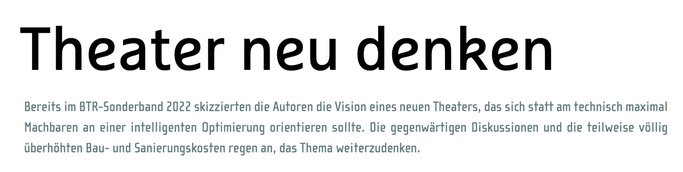
Das Theater ist eine der ältesten kulturellen Institutionen der Menschheit, und seine Baukunst hat sich über Jahrhunderte stets mit den technischen, gesellschaftlichen und künstlerischen Entwicklungen gewandelt. Doch im 21. Jahrhundert steht die Theaterarchitektur vor neuen Herausforderungen. Wesko Rohde, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG), und Sebastian Franssen, Architekt des BürosARCHITEKTUR.DLX, skizzierten bereits 2023 eine Vision eines neuen Theaters, das sich nicht mehr am technisch maximal Machbaren orientiert, sondern an einer intelligenten Optimierung. Die neuerlichen Diskussionen und vor allem die damit verbundenen astronomischen - und teilweise völlig überhöhten - Summen regen dazu an, das Thema weiter zu denken.
Ihr Ziel, damals wie heute: Theater, die exzellent gestaltet, funktional und erschwinglich sind – ohne Kompromisse bei der künstlerischen Qualität.
Ein anschauliches Beispiel für diese Vision ist die Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund. Mit einem Budget von unter 10 Millionen Euro ist sie ein Modellprojekt, das zeigt, wie durch kluge Planung und klare Prioritäten ein hochmoderner Kultur- und Ausbildungsort geschaffen werden kann.
Theaterbauten: Vom Prestigebau zur funktionalen Exzellenz
Historisch waren Theaterbauten häufig Monumente der Machtdemonstration und des Prestiges. Reiche Verzierungen und teure Materialien sollten Größe und Relevanz unterstreichen. In den letzten Jahrzehnten hat sich dieser Anspruch vielerorts in Richtung technologischer Überfrachtung durch überbordende Regelwerke verschoben: Nicht modernste Bühnentechnik, hochkomplexe Steuerungssysteme und intelligente Gebäudestrukturen sind die Kostentreiber, sondern Brandschutz, Normen und Verordnungen, die nur eine Richtung kennen, unabhängig vom Nutzenund deren Regelwerke. Doch mit dieser Entwicklung wuchs auch der finanzielle Aufwand exponential – oft zulasten von Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit, und längst nicht im Sinne der Nutzungen.
Die Theater der Zukunft müssen diesen Ansatz grundlegend überdenken. Nicht das Mögliche, sondern das optimierte Nötige steht im Fokus der Maßnahmen. Es geht darum, Theatergebäude zu schaffen, die funktional, flexibel und auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer zugeschnitten sind – und das alles ohne den Kostenrahmen zu sprengen. Sie dürfen und sollen auch wieder besondere Orte sein, aber nicht zu diesen Preisen.
Flexible technische Strukturen: Anpassungsfähigkeit als Schlüssel
Ein zentrales Element der Theaterarchitektur von morgen ist die Flexibilität der technischen Infrastruktur. Theaterproduktionen werden immer vielfältiger, und die Anforderungen an Bühnenräume ändern sich je nach Inszenierung. Hier setzen modulare Bühnensysteme an: bewegliche Bühnenpodien, anpassbare Tribünensysteme und variable Beleuchtungs- und Akustiklösungen ermöglichen es, Räume für verschiedene Inszenierungsformen zu nutzen. Qualität ist der Schlüssel für die Anforderungen. Theater Spielen und handlungsfähig bleiben.
Die technische Ausstattung sollte dabei nicht maximal, sondern sinnvoll optimiert sein. Wesko Rohde betont, dass viele moderne Theater mehr regelkonforme Einbauten vorhalten, als sie tatsächlich nutzen oder benötigen. Mit dem Maximum wähnt man sich auf der sicheren Seite. Oft nicht zu Gunsten der Spielfähigkeit. Das führt nicht nur zu unnötig hohen Baukosten, sondern auch zu einem extrem hohen und vermeidbaren Wartungsaufwand. Theater können bei der Bühnentechnik gezielt auf modulare Technik und Einbauten setzen, die je nach Bedarf erweitert oder reduziert werden kann.
Nachhaltigkeit durch modulare Bauweise
Die Frage nach der Nachhaltigkeit betrifft nicht nur die technische Ausstattung, sondern auch die Gebäude selbst. Ein zukunftsweisender Theaterbau zeichnet sich durch eine einfache, strukturierte modulare Architektur aus, die nicht nur die Baukosten senkt, sondern auch eine langfristige Anpassungsfähigkeit sicherstellt. Räume können erweitert, umgebaut oder neu konfiguriert werden, ohne dass die Grundstruktur des Gebäudes darunter leidet.
Gezielte Prioritätensetzung durch die Theatermenschen und langfristige Planungen sind der Schlüssel: Räumlichkeiten, die speziell für die Theater optimiert sind, und eine nutzerfreundliche Infrastruktur, die flexibel auf künftige Entwicklungen ohne maximale Nachinvestitionen reagieren kann.
Die Dortmunder Akademie als Vorbild
Mit der Akademie für Theater und Digitalität hat Dortmund eine Blaupause geschaffen, wie Theaterbauten der Zukunft aussehen können. Der Fokus lag hier nicht auf einer möglichst spektakulären Architektur, sondern auf einer intelligenten Nutzung der verfügbaren Mittel. Das Ergebnis ist ein moderner, flexibler und funktionaler Bau, der sowohl den Anforderungen der Gegenwart als auch den Herausforderungen der Zukunft gerecht wird.
Die Akademie zeigt, dass hochmoderne Theaterbauten nicht zwingend teuer sein müssen. Durch eine klare Zielsetzung, effiziente Planung und den Verzicht auf überflüssige technische Ausstattung konnte ein Ort geschaffen werden, der Maßstäbe setzt – und das bei einem Bruchteil der Kosten vieler vergleichbarer Projekte.
Theater-Quartiere: Kultur in greifbarer Nähe
Die Integration von Theatern in urbane Kontexte ist ein weiterer Schlüssel für die Zukunft. Theaterquartiere, die leicht erreichbar sind und kurze Wege bieten, schaffen nicht nur eine stärkere Verbindung zum Publikum, sondern erleichtern auch die logistischen Prozesse der Produktion. Solche Theaterorte sind mehr als reine Veranstaltungsräume; sie werden zu kulturellen Zentren, die in ihrer Umgebung Synergien schaffen. Dafür sind individuelle Planungen regionaler Modelle nötig und möglich.?
Weniger ist mehr: Die Rückbesinnung auf das Wesentliche
Das zentrale Prinzip für das Theater der Zukunft lautet: Weniger ist mehr. Statt sich in technologischen Möglichkeiten zu verlieren, geht es darum, die Kernaufgaben des Theaters – Kunst zu präsentieren und Menschen zusammenzubringen – in den Mittelpunkt zu stellen. Das bedeutet nicht, auf Qualität zu verzichten, sondern sie intelligent zu priorisieren.
Sebastian Franssen (ARCHITEKTUR.DLX)unterstreicht, dass der Fokus auf das Wesentliche nicht nur kosteneffizient ist, sondern auch zu besseren architektonischen Lösungen führt. Wenn(Low-)Technik, Architektur und Nutzung in einem durchdachten Konzept zusammenfinden, entstehen Räume, die sowohl funktional als auch inspirierend sind. Es geht nicht darum, Einschränkungen zu akzeptieren, sondern die vorhandenen Ressourcen bestmöglich zu nutzen.
Regeln anpassen oder ändern
Die HOAI legt die Vergütung von Planungsleistungen strikt nach Leistungsumfang und anrechenbaren Baukosten fest. Dieses System bietet zwar Planungs- und Kalkulationssicherheit, lässt jedoch keinen Raum für die Honorierung von außergewöhnlicher Qualität, kreativen Ansätzen oder innovativen Lösungen. Grundleistungen werden als Standard definiert, während besondere Leistungen nur über gesonderte Vereinbarungen berücksichtigt werden – der Fokus bleibt stark auf Mengen statt auf Ergebnissen.
Für Bauherren, die hohe Ansprüche an Qualität und Nutzerfreundlichkeit haben, wirft dies grundlegende Fragen auf: Ist ein solches Modell für anspruchsvolle Projekte wie Kulturbauten zeitgemäß? Wie können Planer zu Spitzenleistungen motiviert werden, wenn Qualität keine direkte Rolle bei der Honorierung spielt? Ein praxisorientierter Umgang mit der HOAI müsste diese Schwächen adressieren und neue Wege finden, um Qualität und Innovation stärker in den Fokus zu rücken.
Sollten wir gar Prämien einführen, die zur Budgeteinhaltung motivieren, statt Nachträge zur selbstverständlichen Kröte werden zu lassen, die der Bauher zu schlucken hat?
Hätte man jedem der Kölner Planer eine Summe von 1 Mio Euro Erfolgshonorar versprochen und zur planmäßigen Fertigstellung ausgezahlt, man hätte 400 Mio Euro sparen können! Düsseldorf könnte an dieser Stelle die Fehler der ungeliebten Nachbarstadt vermeiden, tut es aber sicher nicht.
Oder wäre es nicht besser, auf allen Ebenen offener mit Kosten umzugehen, um nicht an „politischen“ Budgets zu verzweifeln?
Oder wäre es nicht besser, mit weniger Angst zu bauen und vermeintliche Standards und Anforderungen dutzender Interessenvertretungen mutig zu reduzieren?
Oder wäre es nicht besser, wenn Planende und ausführende Firmen nicht nur deswegen gewählt werden, weil sie das billigste Angebot gemacht haben?
Ein Institut für Kulturbauten
Wir wünschen uns die Gründung eines Instituts für Kulturbauten, das sich darauf spezialisiert, die spezifischen Herausforderungen bei der Planung und Umsetzung von Kulturbauten zielgerichtet anzugehen. Ziel ist es, durch ein professionelles und methodisches Vorgehen nicht nur die Bauzeiten und Kosten erheblich zu reduzieren, sondern auch den öffentlichen Druck auf politische Entscheidungsträger zu minimieren.
Durch die Bündelung von Fachwissen und die Entwicklung standardisierter Verfahren kann das Institut sicherstellen, dass Projekte effizienter, kostengünstiger und mit höherer Qualität realisiert werden. Gerade im Bereich der Kulturbauten, die oft durch ihre Komplexität und den hohen Anspruch an architektonische und technische Lösungen geprägt sind, könnte das Institut als zentrale Anlaufstelle für Projektsteuerung, Beratung und Qualitätsmanagement dienen.
Ein fast undenkbarer Gedanke wäre, dass auf Grundlage von Empfehlungen dieses Institutes Normen kritisch hinterfragt, vermeintliche Mindeststandards sinnvoll unterschritten werden könnten. Eine Mammutaufgabe in unseren aufgeblähten und von Lobbyinteressen durchtränkten Regelwerken.
Theater neu denken
Das Theater der Zukunft wird nicht nur durch technische und bauliche Regeln definiert, sondern vor allem durch kluge Planung und gezielte Prioritätensetzung. Es ist ein Ort, der Exzellenz durch Funktionalität und Nachhaltigkeit erreicht und sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunst und des Publikums orientiert.
Die Vision des “Theaters der Zukunft” lädt dazu ein, Theaterarchitektur neu zu denken. Sie zeigt, dass hochwertige Theaterbauten nicht zwingend teuer sein müssen – wenn man bereit ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. So wird das Theater der Zukunft nicht nur ein Raum für künstlerischen Ausdruck, sondern auch ein Symbol für die intelligente Nutzung von Ressourcen.
Wesko Rohde und Sebastian Franssen

Kommentar schreiben